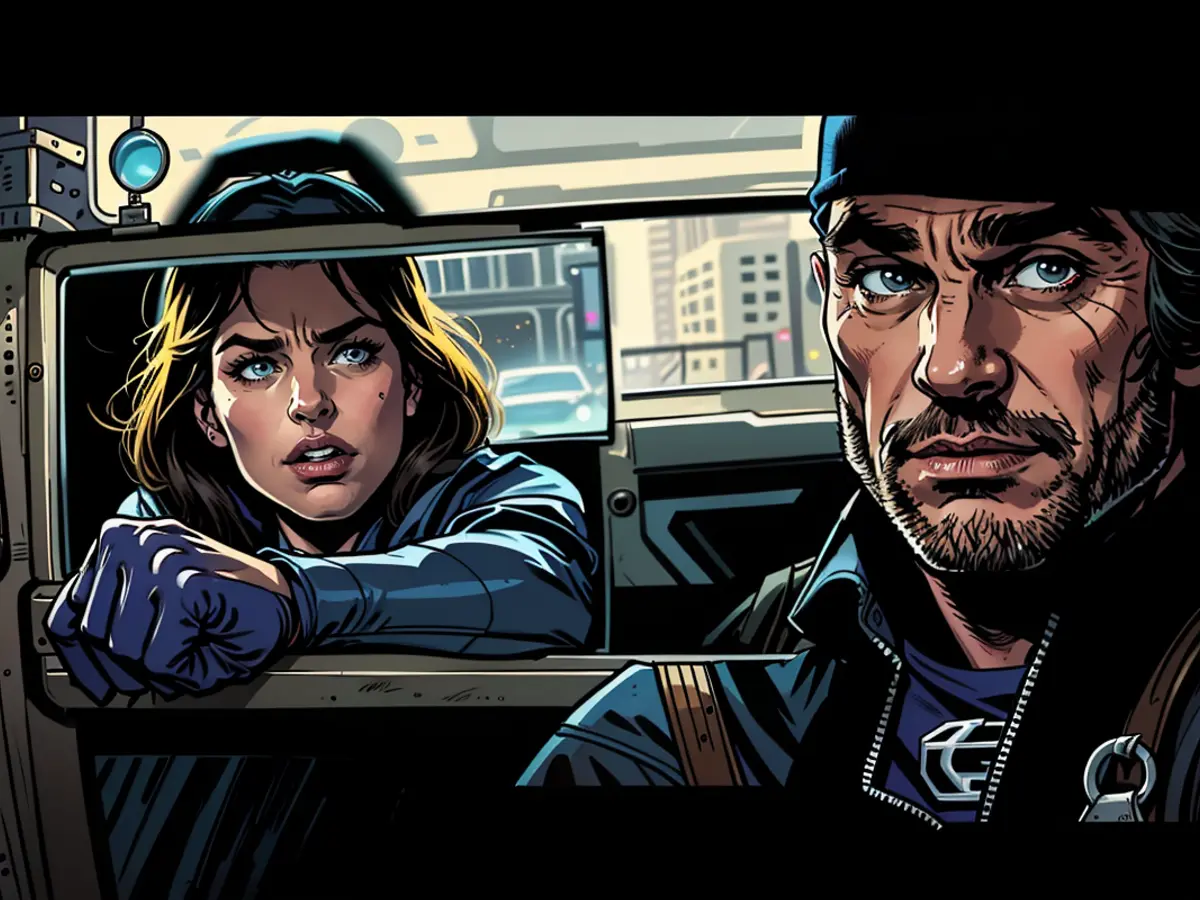Noch nie fühlte sich ein Krieg so nah und greifbar an, wie momentan der Krieg in der Ukraine. Täglich werden wir mit Bildmaterial aus den umkämpften Gebieten überflutet: Zerbombte Städte, brennende Häuser, blutüberströmte und getötete Menschen, verängstigte und verzweifelte Geflüchtete. Es ist längst keine Einbildung mehr, dass wir bei diesem Krieg live dabei sind.
Und dieser Krieg scheint allgegenwärtig zu sein: In den Medien, in Diskussionsrunden am Arbeitsplatz, auf dem Pausenhof in der Schule und selbst im Alltag. Doch der ständige Konsum von negativen Nachrichten sowie die dauerhafte Auseinandersetzung mit dem Geschehen, das uns als Menschen sehr belastet und Sorgen auslöst, können schwere Folgen haben.
Wegschauen oder hinsehen?
Es scheint, als könnten wir in diesen Tagen die Handys gar nicht aus der Hand legen. Und es geht gar nicht darum, dass man sich an den erschütternden Bildern und Berichten „ergötzen“ möchte. Viele Menschen verspüren im Gegenteil ein unerklärliches Schuldgefühl, wenn sie sich von den schrecklichen Nachrichten aus der Ukraine abschotten möchten. Bei vielen geistert immer wieder der Gedanke durch den Kopf, dass die Ukrainer sich ja nicht einfach vom Kriegsgeschehen wegdrehen können. Das verleitet dazu, sich dauerhaft über die Lage informieren zu wollen. Das kann jedoch dazu führen, dass man das Gesehene und Gelesene nicht verarbeiten kann. Die Bilder und Berichte können nicht nur negative Emotionen auslösen, sondern zu einer Verschlechterung des Allgemeinzustands führen.
Beobachter können auch traumatisiert werden
Angesichts der dramatischen Entwicklungen in der Ukraine, scheuen sich momentan viele Personen davor, über ihre eigenen Gefühle zu sprechen. „Mir geht es doch gar nicht so schlecht“, reden wir uns selbst ein, wenn wir an die Bilder von Toten, Verletzten und Geflüchteten denken. Doch das dauerhafte Beobachten des Kriegsgeschehens mit all seiner Grausamkeit kann ebenfalls traumarisierend sein.
Die Menschen sind unterschiedlich belastbar. Die einen können viel ertragen und sich mehr zumuten als andere. Bei einigen ist die Psyche vielleicht vorbelastet (zum Beispiel durch eigene traumatischen Erfahrungen aus der Vergangenheit), dass die ununterbrochene Flut von Kriegsbildern nicht nur zu einem bedrückenden Gefühl, sondern sogar zu einer depressiven Stimmung führen kann.
Bei manchen Menschen geht es viel weiter als nur eine bedrückende Stimmung: Die Nachrichten und Eindrücke aus dem Krieg führen zu einer dauerhaften Beschäftigung mit dem Geschehen und können sogar Appetitverlust, Schlaflosigkeit oder starke Schuldgefühle verursachen. Diesen Zustand nennt man auch „Trauma des Beobachters“. Oft entsteht das Trauma nicht nur aufgrund der Bilder, die wir sehen, sondern auch aus dem Gefühl der Machtlosigkeit heraus. Wenn wir eine Situation nicht kontrollieren können, geraten wir in einen Stresszustand. Der Krieg in der Ukraine riss bei vielen Menschen alte Wunden auf und weckte alte Traumata, die irgendwo im tiefsten Unterbewusstsein schlummerten.
Jedes Mal, wenn wir zum Handy greifen, erhoffen wir uns eine Besserung der Lage. Da unsere Hoffnung jedes Mal aufs Neue zerschlagen wird, versetzt uns das immer wieder in Stress. Auch die eigene Fantasie kann dabei fiese Streiche spielen. Manchmal fällt es sogar schwer, logische Schlussfolgerungen zu ziehen, weil die Angst einen übermannt. Die Folge ist oft ein lähmendes Gefühl, dass einen daran hindert, im Alltag seinen Aufgaben nachzugehen.
Distanz gewinnen
Besorgnis, Angst, Trauer: Das empfinden momentan viele Menschen, wenn es um den Krieg in der Ukraine geht. Dabei müssen sie nicht zwangsläufig Verwandte oder Freunde in den betroffenen Gebieten haben. Es ist unsere Menschlichkeit und unsere Empathie, die uns in diesen Zustand der Sorge und Trauer bringt. Manche Eindrücke verleiten uns dazu, sich in die Situation der Betroffenen zu versetzen, was noch mehr Trauer und innere Lähmung auslöst. Einerseits dürfen diese Emotionen und Reaktionen auch positiv gewertet werden, denn sie unterstreichen das Menschliche an uns – doch jeder hat auch das Recht, an sich selbst zu denken und sich von dem Negativen abzuschirmen.
Um sich selbst zu schützen und vor einem Trauma zu bewahren, sollten die Nachrichten dosiert werden. Es ist verständlich, dass bei einem Ereignis dieser Tragweite (vor allem, wenn zudem noch eine persönliche Betroffenheit besteht), viele Menschen immer up-to-date sein möchten. Vielleicht empfiehlt sich als eine Option, nicht jede halbe Stunde, sondern nur einmal oder zweimal am Tag die Nachrichten zu verfolgen – und auch das über einen bestimmten Kanal und nicht quer durch. Dadurch, dass man öfter zum Handy greift oder jede Nachricht aus der Ukraine aufsaugt, wird die Situation sich weder verändern noch bessern.
Auf dem Arbeitsplatz oder im Alltag kann man sich ebenso von diesem Thema abgrenzen. Das sollte vielleicht aber nicht unbedingt auf eine Art vermittelt werden, dass man davon nichts wissen will, sondern ehrlich erklären, warum die ständige Auseinandersetzung so auf die Stimmung drückt und vielleicht sogar noch schwerwiegendere Folgen hat.
Gefühle zulassen
Nichts kann sich mit dem Leid der Menschen, die gerade vom Krieg betroffen sind, messen. Wie intensiv wir uns mit dem Thema auch auseinandersetzen, wir werden nie vollständig nachfühlen oder nachvollziehen können, was Menschen in einem Krieg erleben.
Aufgrund dieser Erkenntnis scheuen sich momentan viele, über ihre Gefühle zu sprechen. Man möchte ja nicht „auf hohem Niveau“ jammern. Doch das Unterdrücken von Gefühlen bringt noch weniger. Außerdem ist es völlig in Ordnung, dass dieser Krieg gewisse Ängste und Unsicherheiten auslöst.
In so einer schwierigen Zeit, ist es im Gegenteil wichtiger denn je, Gefühle zulassen und zeigen zu können. Sie sind ein Teil unseres menschlichen Ichs. Wenn wir die Emotionen über eine längere Zeit unterdrücken, können sie eine verheerende Kraft entwickeln, die sich später leider auf eine negative Weise entladen und uns selbst schaden zufügen kann.
Auch hilft es, über die eigenen Sorgen und Ängste zu sprechen. Es sind nicht nur die verstörenden Bilder und die dramatischen Berichte aus der Ukraine, die uns belasten, sondern auch die eigenen (Zukunfts-)Ängste, die uns beunruhigen.
Ablenkung suchen und trotzdem nah dran sein
Wenn man die Nachrichten auch mal ausschaltet oder nicht ständig auf Social Media die Berichte aus dem Kriegsgebiet liest, wird man dadurch nicht zu einem schlechteren Menschen. Kommt man von dem Ukrainekrieg nicht ganz los, hilft eine sinnvolle Beschäftigung im Alltag. Doch auch Ablenkung fällt momentan vielen sehr schwer, da das Thema so präsent ist. Einige Menschen möchten auch nicht wegschauen, weil diese Abschirmung sie noch mehr belastet.
Das bereits erwähnte Gefühl der eigenen Machtlosigkeit kann sehr gut überwunden werden, in dem man selbst aktiv wird. Dabei muss es nicht gleich etwas Großes sein. Auch bei Hilfe sollte man seine Kräfte dosieren und die eigenen Grenzen kennen.
Vielleicht kann man selbst etwas für die betroffenen Menschen spenden, an einer Sammelaktion von Hilfsgütern und Spenden mitwirken, nach Möglichkeit sprachlich und ehrenamtlich bei der Aufnahme von Geflüchteten unterstützen, oder auch einfach nur durch menschliche Gespräche für die Betroffenen da sein. Helfen für einen bestimmten Zweck ist eine gute Methode, um sich abzulenken und trotzdem nah am Thema bleiben zu können. Außerdem können positiven Erlebnisse und Emotionen, die aus der eigenen Hilfsbereitschaft und dem Engagement resultieren, dabei helfen, das bedrückende Gefühl zumindest für eine Weile zu dämpfen oder ganz abzuschalten.